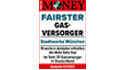Wärmewende für eine klimafreundliche Zukunft
Die SWM setzen auf erneuerbare Energien. Da die meiste Energie für die Wärmeversorgung, also zum Heizen oder für Warmwasser, eingesetzt wird, treiben wir die Energiewende auch im Wärmemarkt voran. Denn bis spätestens 2040 wollen wir den Münchner Bedarf an Fernwärme CO₂-neutral decken, überwiegend durch Tiefengeothermie. Den restlichen Wärmebedarf adressieren wir durch weitere Wärmelösungen, wie Nahwärme und Wärmepumpen.
Wärmewende: Ein wichtiger Teil der Energiewende
Mehr als 50 Prozent der gesamten Energie, die in Deutschland verbraucht wird, fließt in die Wärmeversorgung, wird also fürs Heizen, Kühlen oder die Warmwasserbereitung benötigt. In Privathaushalten machen Heizung und Warmwasser sogar rund 90 Prozent des gesamten Verbrauchs aus (Quelle: www.umweltbundesamt.de
Um bei der Energiewende erfolgreich zu sein, müssen wir daher vor allem auch eine Wärmewende erreichen. Dazu haben wir im Jahr 2012 eine Fernwärme-Vision entwickelt: Wir wollen den Münchner Bedarf an Fernwärme bis spätestens 2040 CO2-neutral decken, überwiegend mit Ökowärme aus Tiefengeothermie. Parallel dazu wird das Fernwärmenetz für die Ökowärme fit gemacht. Außerdem bieten wir als zukunftsfähige Wärmelösungen neben der Fernwärme auch Nahwärme und Wärmepumpen an.
Ziel ist es, die Kraftwerke langfristig CO2-neutral zu betreiben. Dabei ist es für uns jedoch elementar, die Energieversorgung der Münchner*innen jederzeit sicherzustellen. Deshalb vollziehen wir den Wandel hin zur erneuerbaren Energiewelt schrittweise. Der Kohleausstieg wurde 2024 umgesetzt, auf Erdgas kann im Energiemix der SWM aber noch nicht verzichtet werden.
Mit dem Prozess der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) nutzen wir das Erdgas, den saubersten unter den fossilen Energieträgern, so effizient wie möglich: 90 Prozent der Energie aus dem Erdgas werden zur Erzeugung von Strom und Wärme genutzt. Zudem modernisieren wir unsere KWK-Anlagen, so dass sie noch effizienter arbeiten. Wenn technisch machbar, sollen sie künftig auch mit regenerativen Brennstoffen wie Biomethan oder Wasserstoff betrieben werden können. Durch die Integration von Tiefengeothermie wird die CO2-Bilanz der Fernwärme weiter verbessert.
Kommunale Wärmeplanung
Deutschland hat sich das politische Ziel gesetzt, die Wärmeversorgung bis 2045 klimaneutral zu gestalten. Um den Bürger*innen für anstehende Heizungs-Entscheidungen die richtigen Informationen an die Hand zu geben, müssen Städte und Gemeinden kommunale Wärmepläne entwickeln. Diese berücksichtigen die aktuelle Wärmeversorgung und informieren darüber, welche Art der Wärmeversorgung an welchem Standort als besonders geeignet und am kostengünstigsten gilt. Die Landeshauptstadt München ist hier schon sehr weit und hat im Herbst 2024 ihre Wärmeplanung verabschiedet.
Fernwärme-Transformationsplan der SWM
Vor allem CO2-neutrale Fernwärme wird für Münchens Wärmeversorgung künftig eine zentrale Rolle spielen. Um die Münchner Fernwärme nach und nach zu dekarbonisieren, haben die SWM einen Transformationsplan erarbeitet. Der Transformationsplan zeigt auf, wie wir das Fernwärmesystem und unsere Wärmeerzeugung hin zu einer CO2-neutralen Fernwärme aus- und umbauen wollen.
Um den Transformationsplan umzusetzen, muss das Fernwärmenetz intensiv verdichtet sowie ausgebaut und modernisiert werden. Die Geothermie in München und Region muss vorangetrieben und es müssen neue Anlagen – zum Teil in Kooperation mit Partnern – errichtet werden.
Fernwärme: Für Liegenschaften im geplanten Fernwärmegebiet
Was ist Fernwärme?
M-Fernwärme wird zentral und überwiegend in Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) produziert, in den KWK-Anlagen des Heizkraftwerks Nord und des Energiestandorts Süd. Dabei wird die Abwärme, die bei der Stromerzeugung entsteht, nicht wie bei herkömmlichen Kraftwerken an die Umwelt abgegeben, sondern zur Wärmeversorgung genutzt: Die Wärme kommt als heißes Wasser oder Dampf über Rohre zu den Verbraucher*innen. Das Wasser bzw. der Dampf gibt seine Wärme an das Heizsystem der Gebäude ab, so dass sie zum Heizen der Räume oder von Wasser genutzt werden kann. Das so abgekühlte Heizwasser bzw. das Kondensat aus der Fernwärmeanlage wird anschließend zum Heizkraftwerk zurückgeleitet und erneut erwärmt. So funktioniert der Fernwärme-Kreislauf.
Durch die Kopplung von Strom- und Wärmeerzeugung wird der eingesetzte Brennstoff gegenüber getrennten Erzeugungsmethoden wesentlich effizienter verwendet.
Welche Kraftwerke der SWM das Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung nutzen, erfahren Sie hier: Kraft-Wärme-Kopplung
Platzsparend, ökologisch und versorgungssicher: Erfahren Sie mehr zu den Vorteilen von Fernwärme: Fernwärme
Sie interessieren sich für eine Versorgung mit M-Fernwärme?
Kontaktieren Sie uns. Wir sind gerne für Sie da.
- Telefon: 0800 796 107 7 *
- E-Mail: fernwaerme@swm.de
* kostenfrei innerhalb Deutschlands
Modernisierung des Fernwärmenetzes
Um die Wärme der Tiefengeothermie im Münchner Fernwärmenetz nutzen zu können, rüsten die SWM das in manchen Bereichen Münchens noch genutzte alte Dampfnetz in den nächsten Jahren zu einem Heizwassernetz um. Durch die Integration von Tiefengeothermie wird die jetzt schon gute CO2-Bilanz der Fernwärmeerzeugung kontinuierlich verbessert.
Warum die Umrüstung erforderlich ist? Die Wärme aus der Tiefengeothermie wird in Form von ca.120 Grad Celsius heißem Wasser an die Oberfläche gebracht und kann aufgrund dieser „niedrigen” Temperatur nicht über das Dampfnetz genutzt werden. Es braucht ein Heizwassernetz, das energiewirtschaftlich besser ist und sich auch besser mit der Nutzung von Tiefengeothermie vereinbaren lässt.
Außerdem verbinden wir Abschnitte des Heizwassernetzes miteinander, um eine möglichst hohe Auslastung der Geothermieanlagen zu gewährleisten.
Geothermie
Was ist Geothermie?
Erdwärme ist eine natürlich vorkommende Energieart aus dem Erdinneren – primär gespeichert im Gestein und in den darin zirkulierenden Flüssigkeiten und Gasen (z. B. Wasser oder Wasserdampf). Dort, wo ausreichend heißes Wasser in größeren Mengen an die Erdoberfläche geholt werden kann, ist eine technische Nutzung wirtschaftlich und nachhaltig möglich. Die Energie kann direkt als Wärme oder zur Erzeugung von Strom oder Kälte genutzt werden.
Die oberflächennahe Geothermie nutzt die Erdwärme bis zu Tiefen von 400 Metern und wird häufig im privaten Wohnungsbau eingesetzt. Von Tiefengeothermie spricht man bei der Nutzung der Erdwärme aus über 400 bis zu mehreren tausend Metern Tiefe.
In München gibt es ein riesiges Vorkommen dieser natürlichen Energie: In einer Tiefe von 2.000 Metern (nördliche Stadtgrenze) bis über 3.000 Metern (südliche Stadtgrenze) unter der Erdoberflache befindet sich eine wasserführende Gesteinsschicht mit Wassertemperaturen von 80 bis über 100 Grad Celsius.
Wie Geothermie funktioniert und welche Vorteile sie bietet? Das erfahren Sie hier:
Funktionsweise Geothermie
Nord-Süd-Schnitt durch das Voralpenland
SWM: Vorreiter der Tiefengeothermie
Wir sind eines der führenden deutschen Unternehmen für die Erschließung und Nutzung der Tiefengeothermie. Wir haben bereits jahrelange Erfahrung mit dieser Technik und betreiben seit 2004 erfolgreich mehrere Geothermieanlagen in München und der Region.
Ausbau der Geothermie in und um München
Derzeit wird Erdwärme im Großraum München mit einer thermischen Leistung von ca. 400 Megawatt genutzt. Das noch vorhandene Potenzial wird auf mehr als ein Gigawatt (1.000 Megawatt) geschätzt. Um dieses zu erschließen, bauen wir die Geothermie im Stadtgebiet und in der Region aus, auch in Kooperation mit benachbarten Gemeinden, Bergrechteinhabern und anderen Unternehmen.
Vibro-Seismik: das Ohr in die Tiefe
Mit geophysikalischen 3D-Untersuchungen des Untergrundes prüfen wir, welche Gebiete sich für eine Geothermie-Nutzung eignen. Bereits mehr als 10 Millionen Euro haben wir in Messungen investiert.
Weitere Erkundungsmessungen sind im gesamten Großraum München geplant. Diese nimmt das Forschungsprojekt GIGA-M unter Federführung der Technischen Universität München vor. Beteiligt sind neben den den SWM auch der Landkreis München, die Energieagentur Ebersberg-München, die Landeshauptstadt München sowie die Energie-Wende Garching.
Mehr zu GIGA-M
Die Messungen werden im umweltschonenden Vibroseis-Verfahren durchgeführt: An der Erdoberflache erzeugen Vibro-Fahrzeuge Schallwellen. Diese werden im Untergrund von verschiedenen Gesteinsschichten in unterschiedlichen Tiefenlagen reflektiert (Reflexionsseismik). An der Oberfläche weiträumig verlegte, hochempfindliche Erdmikrophone (Geophone) registrieren die reflektierten Schallwellen. So entsteht ein dreidimensionales Bild des Untergrunds, auf dem man den Verlauf und die Ausbildung von Gesteinsformationen, die Thermalwasser enthalten, erkennen kann.
Film zur Seismikerkundung Anfang 2020
2020 haben wir den südöstlichen Landkreis München mit Seismik erkundet. Unser Ziel: herauszufinden, wie viel weiteres Potenzial in der Erdwärme steckt. Rund 3 Wochen lang haben Vibro-Fahrzeuge den Untergrund untersucht. Von den Ergebnissen der Messungen profitiert nicht nur München, sondern auch die Kommunen in der Region.
Ausbau der Tiefengeothermie in München
Die nächste Geothermieanlage der SWM wird im Münchner Süd-Osten, auf dem Gelände des Michaelibads, errichtet. Im Untergrund wurden günstige geologische Verhältnisse erkannt, die eine hohe Temperatur und Förderrate des Thermalwassers erwarten lassen. Hinzu kommt, dass die Anlage hier gut in das bestehende Fernwärmenetz eingebunden werden kann, um die Wärme zu den Kund*innen zu bringen.
Ausbau der Tiefengeothermie in der Region
Die Zusammenarbeit mit der Region ist ebenfalls wichtig. Denn die SWM betreiben auch in Kirchstockach, Dürrnhaar und Sauerlach Geothermieanlagen. Diese produzieren vor allem umweltfreundlichen Ökostrom und sollen langfristig überwiegend auf die Produktion von Fernwärme umgestellt werden. Die Geothermieanlagen sollen künftig nicht nur angrenzende Gemeinden versorgen, sondern über eine Fernwärmetrasse in das SWM Fernwärmesystem eingebunden werden.
Partnerschaften in der Region
In der Region um München sind neben uns weitere Wegbereiter der Geothermie aktiv. Um den Bodenschatz geologisch, ökologisch und ökonomisch optimal nutzen zu können, wollen wir mit regionalen Energieversorgern unsere Erfahrung und Ressourcen bündeln. Wir sind mit verschiedenen Partnern im Gespräch, um Machbarkeiten gemeinsamer Geothermieanlagen zu prüfen. Außerdem entwickeln wir gemeinsam Konzepte zur Erschließung des geothermischen Reservoirs und zur Verknüpfung der Fernwärmenetze. Durch diese Kooperationen können die Geothermieanlagen besser in den Netzen eingebunden und vor allem das Geothermiepotenzial in und um München optimal genutzt werden.
Nahwärme: Für Quartiere, Siedlungen, Baublöcke oder Straßenzüge
Nahwärme: lokal und dezentral
Für eine nachhaltige Wärmeversorgung entwickeln wir unser Produktangebot für Wärmelösungen beständig weiter. Dort, wo es keinen Fernwärmeanschluss gibt, kann beispielsweise Nahwärme eine Lösung sein.
Im Gegensatz zur Fernwärme, die in großen Anlagen produziert wird, erzeugen wir Nahwärme aus Energiequellen in unmittelbarer Nähe der Gebäude, die damit versorgt werden. Und im Gegensatz zu einer Eigenversorgungslösung teilen sich die Haushalte die benötigte Infrastruktur.
Damit ist Nahwärme eine zukunftsfähige Lösung für bestehende Quartiere und Liegenschaften, deren Wärmeversorgung auf eine nachhaltige und effiziente Quelle umgestellt werden soll. Aber auch in Neubaugebieten lässt sich M-Nahwärme einsetzen.
Wir versorgen einzelne Gebäude, kleinere Gebiete oder Quartiere mit M-Nahwärme und übernehmen Planung, Bau, Wartung und Instandhaltung der gemeinsam genutzten Anlagen und nach Wunsch auch der Wärmeerzeugungsanlagen. Als Energiequelle nutzen wir in der Regel Grundwasser – je nach Versorgungskonzept auch zur Gebäudekühlung.
Wärme und Kälte aus Grundwasser: Oberflächennahe Geothermie
Der Großraum München bietet ideale Voraussetzungen für eine Versorgung mit Wärme und Kälte aus Grundwasser. Ein erheblicher Anteil des Münchner Wärme- und Kältebedarfs kann damit gedeckt werden.
Mehr über die oberflächennahe Geothermie und die Erzeugung von Wärme und Kälte aus Grundwasser erfahren Sie hier: Oberflächennahe Geothermie
Sie haben Fragen zu M-Nahwärme oder möchten sich beraten lassen?
Kontaktieren Sie uns. Wir helfen gerne weiter.
- E-Mail: nahwaerme@swm.de
Wärmepumpen: Für Einfamilienhäuser, Doppelhaushälften und Mehrfamilienhäuser
Wärmepumpe: Die dezentrale Alternative zum Öl- oder Gaskessel
Die SWM liefern nicht nur Energie. Wir rüsten Haushalte auch mit umweltschonender Technik für die Eigenversorgung aus, beispielsweise mit der M-Wärmepumpe.
Wärmepumpen nutzen Umweltwärme, z. B. aus dem lokalen Grundwasser oder der Umgebungsluft, um Gebäude zu beheizen. Auf diese Weise können Heizungen ersetzt werden, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden.
Die Technik funktioniert für Neu- wie für Bestandsbauten. Der Austausch bestehender Heizungen gegen eine M-Wärmepumpe wird mit Förderprogrammen unterstützt. Die SWM stehen bei der Umrüstung auf eine M-Wärmepumpe sowohl in Einfamilienhäusern, Zweifamilienhäusern und kleineren Mehrfamilienhäusern als verlässlicher Partner zur Seite – von der Beratung über die Planung und Installation der Wärmepumpe bis hin zur Wartung.
Vorteile von Wärmepumpen
- Nachhaltig und zukunftssicher
Mit einer M-Wärmepumpe erfüllen Sie die Anforderungen aus dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) und heizen auf dem neusten Stand der Technik. -
Energie- und kosteneffizient
Gegenüber herkömmlichen, auf fossilen Brennstoffen basierenden Heizungen profitieren Sie mit einer Wärmepumpe von potenziell niedrigeren Betriebskosten und einem geringeren Energieverbrauch. In Kombination mit einer Photovoltaikanlage können Sie den Strombedarf Ihrer Wärmepumpe zudem unabhängig decken und die Betriebskosten weiter senken. -
Flexibel
Wärmepumpen eignen sich für ein breites Spektrum an Bestandsgebäuden. Durch unsere fachgerechte Planung und Umsetzung heizen Sie auch mit gewöhnlichen Heizkörpern effizient
Sie planen eine Wärmepumpe oder möchten sich dazu informieren?
Kontaktieren Sie uns. Wir beraten Sie gerne!
Weitere Maßnahmen für die Wärmewende und Beispielprojekte
Investition in Biomasse-Heizkraftwerk
Um die Wärmeerzeugung flexibel zu gestalten, setzen wir neben der Geothermie auf weitere umweltfreundliche Erzeugungsmethoden. Seit 2018 betreiben wir beispielsweise auch ein Biomasse-Heizkraftwerk in Taufkirchen. Dieses nutzt regional anfallende Biomasse z. B. aus Landschaftsbau und der Grünpflege, um Taufkirchen und angrenzende Gemeinden mit Strom und Fernwärme zu versorgen. Es erzeugt rund 25.000 MWh Ökostrom pro Jahr, genug für etwa 10.000 Haushalte, sowie rund 150.000 MWh Ökowärme.
Studie: Langzeitwärmespeicher in der Nah- und Fernwärme
Wenn den Wärmebedarf schwankt, z. B. wegen der Jahreszeit, müssen wir flexibel reagieren können. Üblicherweise werden dafür lokale Warmwasserspeicher genutzt, wie sie in vielen Gebäuden installiert sind.
Ökologisch besonders interessant wäre aber, wenn man z. B. die Wärme des Sommers (beispielsweise aus Solarthermie) für den Winter speichern könnte. Die dafür nötigen saisonalen Langzeitwärmespeicher müssten im Vergleich zu den heute üblichen Warmwasserspeichern wesentlich mehr Energie über einen viel längeren Zeitraum speichern können. In einer Studie untersuchen wir, wie sich Tiefenspeicher, also unterirdische Langzeitwärmespeicher, technisch, ökologisch und wirtschaftlich realisieren lassen.
-
Geothermische Anlage: Bürogebäude in der Balanstraße
Für ein Bürogebäude an der Balanstraße bauen wir eine geothermische Anlage, die mit oberflächennahem Grundwasser und Fernwärme Wärme und Kälte bereitstellen soll. Aus drei „Förderbrunnen“ wird das Grundwasser aus einer Tiefe von ca. 15 bis 20 Metern entnommen und in die Kundenanlage geleitet. Dort gibt es seine thermische Energie mittels Wärmetauscher ab. Anschließend wird das Wasser über zwei „Schluckbrunnen“ wieder zurück in die Erde geleitet.
Mit Hilfe von Wärmepumpen kann die thermische Energie des Grundwassers auf verschiedene Temperaturniveaus erwärmt oder zur Kühlung eingesetzt werden. Wir verwenden dafür eine Technik, die das Wasser nicht verändert. Es ist nach der Nutzung lediglich geringfügig wärmer bzw. kälter als bei der Entnahme. Nach der Rückleitung in den Untergrund regeneriert sich das Grundwasser nach gewisser Zeit wieder und gilt damit als erneuerbare Wärme- und Kältequelle.
Niedertemperatur-Wärme
-
Solare Nahwärme: Pilotprojekt am Ackermannbogen
Bereits im Jahr 2006 haben die Landeshauptstadt München, das Bayerische Zentrum für Angewandte Energieforschung e.V. (ZAE Bayern) und die SWM das Pilotprojekt „Solare Nahwärme Ackermannbogen“ umgesetzt. Ziel war es, ein Neubaugebiet rund ums Jahr zu mindestens 50 Prozent mit Sonnenenergie für Heizung und Warmwasser zu versorgen. Ausgewählt wurde hierfür ein Teilabschnitt des neuen Stadtquartiers „Am Ackermannbogen“ mit insgesamt 320 Wohneinheiten.
-
Wohnanlage in der Postillonstraße im Fernkältenetz Moosach
In der Münchner Postillonstraße nutzen wir Abwärme, die aus einem mit Grundwasser betriebenen Fernkältenetz entsteht, um mit zwei Wärmepumpen (siehe Foto) Wärme für 114 Werkswohnungen mit ca. 8.000 m2 Wohnfläche zu erzeugen. Eine PV-Anlage erhöht den regenerativen Anteil der Energieversorgung des Gebäudes weiter und rundet die Anlage zu einem energetisch ganzheitlich gedachten Konzept ab.
Mit diesem preisgekrönten und innovativen Konzept – einem Referenzprojekt des Bundesverbands Wärmepumpe – setzen wir Maßstäbe für eine nachhaltige, effiziente und klimaneutrale Wärmeversorgung.