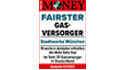Der neue Energiestandort Süd
17.03.2025 | Am Energiestandort Süd in München-Sendling wird bereits seit 1899, also seit mehr als 120 Jahren, Strom für die Stadt München erzeugt. Im Laufe der Jahre wurde der Standort immer wieder modernisiert und an den steigenden Energiebedarf der Stadt angepasst. Denn die Zukunft gehört den Erneuerbaren Energien.
Effektive Kraft-Wärme-Kopplung
Das Heizkraftwerk (HKW) Süd ist der älteste konventionelle Erzeugungsstandort der SWM. Seit 1899, also seit mehr als 120 Jahren, wird in Sendling Energie für München erzeugt.
Nach Phasen mit Kohle- und Müllverbrennung ist seit rund zwei Jahrzehnten im Heizkraftwerk Süd die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) Stand der Technik, also die gleichzeitige Erzeugung von Strom und Fernwärme. Erdgasbetriebene Turbinen erzeugen Strom, die heiße Abwärme wird in Fernwärme umgewandelt. Bis zu 90 Prozent der Energie aus dem Erdgas werden so genutzt – damit ist die KWK eine der effektivsten und klimafreundlichsten konventionellen Erzeugungsmethoden.
Erdgas als den saubersten der fossilen Rohstoffe benötigen wir noch solange, bis wir die Energie für München komplett CO2-neutral erzeugen können.
Geothermie, Fernkälte, Energiespeicher
Seit Ende 2021 produziert die aktuell größte Geothermieanlage Deutschlands hier Ökowärme für die Münchner*innen. Außerdem wurde und werden die Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen modernisiert, um noch effizienter Strom und Wärme zu erzeugen. Ende 2022 ging die erneuerte GuD2 (Gas- und Dampfturbinenanlage) in Betrieb. Bis voraussichtlich Ende 2025 wird auch die GuD1 modernisiert. Um die Energiewende ganzheitlich voranzutreiben wurde zudem eine Kälteerzeugung gebaut und ein Wärmespeicher ist in Entstehung.
Erweiterung und Modernisierung
Der Energiestandort Süd wird zeitgleich an mehreren Stellen weiterentwickelt, um den Ansprüchen der neuen Energiewelt gerecht zu werden.
Regenerative Wärmeerzeugung: Größte Geothermieanlage Deutschlands
Auf dem Areal zwischen Isarkanal, Schäftlarnstraße und Großmarkthalle haben wir die größte Geothermieanlage Deutschlands errichtet, mit sechs Bohrungen, die in Tiefen von 2.400 bis 3.200 Metern reichen. Die Anlage produziert seit Mitte 2021 Fernwärme.
Die Geothermieanlage am Energiestandort Süd verfügt über eine Fernwärmeleistung von rund 60 MW. Damit können Teile der Innenstadt, Perlach und Sendling mit Ökowärme versorgt werden. Bei den Kund*innen wird die Wärme zum Heizen genutzt und das abgekühlte Wasser fließt zurück in die Geothermieanlage, wo es erneut durch Thermalwasser aufgeheizt wird.
Bis voraussichtlich Anfang 2026 soll die Geothermieanlage mit einem Wärmespeicher erweitert werden. Mit ihm lässt sich die geothermale Wärme noch besser nutzen.
Rohbau des Wärmespeichers
Bau eines Wärmespeichers
Neben der Geothermieanlage bauen wir momentan einen ca. 50 m hohen Wärmespeicher mit einem Fassungsvermögen von etwa 57.000 m3. Mit knapp 40 Metern Durchmesser und 50 Metern Höhe hat er ein Brutto-Fassungsvermögen von rund 57.000 Kubikmetern Fernwärmewasser. Die Fertigstellung ist für Anfang 2026 geplant.
Strom und Wärme flexibel nutzen
Mit Hilfe des Wärmespeichers können wir also die Anlagen flexibler nutzen: Wird viel Strom benötigt, aber wenig Wärme, kann die überschüssige Wärme gespeichert werden. Wird dagegen wenig Strom aus dem Kraftwerk benötigt – zum Beispiel, weil viel Strom aus erneuerbaren Energiequellen im Netz ist – und die Produktion gedrosselt, wird auch weniger Wärme erzeugt. Dann kann auf die Wärme im Speicher zurückgegriffen werden.
So funktioniert der Wärmespeicher
Alle Anlagen am Energiestandort Süd können Wärme in Form von heißem Wasser im Wärmespeicher „zwischenlagern“. Bei Bedarf wird das Wasser über das Heizwasser-Fernwärmenetz zu den Kunden transportiert. So lässt sich die geothermale Wärme noch besser nutzen und gleichzeitig erhöht der Speicher die Versorgungssicherheit. Sollte einmal eine Anlage ausfallen, kann der Speicher die benötigte Wärme liefern – über einen kurzen Zeitraum sogar mit der mehrfachen, bis zu sechsfachen Leistung der Geothermieanlage.
Film: Wärmespeicher für den Energiestandort Süd
Zur Verfügung gestellt von muenchen.tv
Erneuerung der Technik
Solange für die Strom- und Wärmeerzeugung noch nicht ganz auf Erdgas verzichtet werden kann, wollen wir den saubersten unter den endlichen Rohstoffen so effizient wie möglich nutzen. Die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) ist eine der effektivsten und klimafreundlichsten konventionellen Erzeugungsmethoden in Heizkraftwerken. Sie nutzt rund 90 Prozent der Energie aus dem Erdgas.
Derzeit erzeugen zwei Gas- und Dampfturbinenanlagen (GuDs) Strom und Wärme in umweltschonender und effizienter Kraft-Wärme-Kopplung. Eine der GuDs wurde bereits modernisiert. Die zweite wird ebenfalls modernisiert und voraussichtlich Ende 2025 in Betrieb gesetzt. Zusätzlich ist seit 2014 eine Power-to-Heat-Anlage im Einsatz, die Strom zu Wärme umwandelt.
Eine der beiden neuen Turbinen der Gas- und Dampfturbinenanlage 2 (GuD2)
Umweltfreundliche Fernkälteerzeugung
Am Energiestandort Süd wird auch Kälte erzeugt: Die Kälteanlage nutzt das kalte Wasser des Isarwerk-Kanals, aber auch Energie aus den KWK-Anlagen und der Geothermie, um Fernkälte zu erzeugen. Die Fernkälte strömt über eine neu entstandene 5 km lange Transportleitung durch die Isarvorstadt und Ludwigsvorstadt in die Innenstadt. Kund*innen entlang der Trasse und in der Innenstadt können damit ihre Gebäude kühlen, ganz ohne Kälteanlage.
-
Weitere Infos zur EU-Förderung
Das Projekt „Innovative und CO2-arme Fernkälteversorgung für das Münchner Innenstadtquartier“ wird durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gefördert. Insgesamt erhalten die SWM 3,28 Millionen Euro aus diesem Programm. Fördergeber sind die EU (50 %), der Freistaat Bayern (10 %) und die Landeshauptstadt München (40 % kommunaler Eigenanteil).
Im Rahmen dieses innovativen Projekts errichten die SWM am Energiestandort Süd eine neue Kälteerzeugungsanlage, um in Zukunft zahlreiche Kunden in der Münchner Innenstadt mit ökologischer Kälte versorgen zu können. Der Energiestandort Süd, an dem die SWM seit vielen Jahren Fernwärme aus hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen und in Zukunft auch aus erneuerbarer Tiefengeothermie erzeugen, bietet beste Voraussetzungen, um klimafreundliche und ressourcenschonende Kälte bereitzustellen. Denn bevorzugt setzen die SWM hier Fließwasser aus dem Isar-Werkkanal und Fernwärme als Antriebsquelle in Absorptionskältemaschinen ein. Zur Abdeckung der Spitzenlasten werden hocheffiziente strombetriebene Kompressionskälteanlagen verwendet. Damit lassen sich im Vergleich zu den sonst üblichen dezentralen Kühlanlagen in den einzelnen Gebäuden circa zwei Drittel der CO2-Emissionen einsparen.
Die Erzeugungsanlage soll 2022 in Betrieb gehen. Ab etwa 2028 wird in den Sommermonaten überschüssige Fernwärme aus erneuerbaren oder CO2-neutralen Quellen (Geothermie, Müllverbrennung) zur Verfügung stehen.
Zur Kälteeinspeisung verlegen die SWM ein über 6 km langes Transportnetz, das bereits größtenteils fertiggestellt ist. Um die großen Kundenpotenziale in der Münchner Innenstadt zu erschließen, wird bis 2022 der Energiestandort Süd an den beiden Anschlusspunkten in der Nähe Hauptbahnhof und Tal/Marienplatz mit dem bereits bestehenden Fernkältenetz verbunden. Die Trasse dieser neuen Transportleitung führt auch am Areal der Großmarkthalle sowie an städtischen Verwaltungsgebäuden sowie Krankenhäusern vorbei, so dass auch Fernkältekunden entlang der Trasse angeschlossen werden können.
Das Projekt hat einen sehr positiven städtebaulichen Einfluss: Durch die zentrale Fernkälteversorgung können unerwünschte Rückkühlaggregate auf den Dächern der Innenstadt vermieden werden, welche das Stadtbild nachteilig beeinflussen und in ungünstigen Fällen hygienische Probleme (Legionellen) verursachen können. Ebenso verbessert sich das Mikroklima, da die Wärmeabfuhr der Rückkühlgeräte dezentraler Klimageräte in der ohnehin aufgeheizten Innenstadt vermieden wird.
Die umweltfreundliche und CO2-arme Fernkälteversorgung trägt wesentlich zu den ambitionierten Klimaschutzzielen und den Aktivitäten zur Klimaanpassung der Stadt München bei. Das Konzept des Projekts berücksichtigt auch den in Zukunft wachsenden Kältebedarf als Folge des Klimawandels und steigender Komfortansprüche der Kund*innen.
Innovative und CO₂-arme Fernkälteversorgung für das Münchner Innenstadtquartier mit Quartiersgrenze des EFRE-Förderprojekts sowie Fernkältenetz (Planungsstand und Fertigstellungsgrad)
So wird der Energiestandort Süd zukünftig aussehen: links das modernisierte HKW Süd, in der Bildmitte der Wärmespeicher und daneben das Technikgebäude, in dem auch die Fernkälte ausgekoppelt wird. (Visualisierung: SWM/SCG Architekten)
Infocontainer am Energiestandort Süd
Sie haben die Möglichkeit, sich im Infocontainer am Tor 3 über die aktuellen Bauvorhaben im Kraftwerk Süd zu informieren. Das Tor 3 befindet sich in der Schäftlarnstrasse 15, gegenüber der Einfahrt zur Großmarkthalle. Der Infocontainer ist werktags zwischen 8 und 17 Uhr geöffnet. Falls der Container geschlossen ist, bitte an der Pforte Tor 3, Schäftlarnstraße 15 melden.
Neue Energiewelt
Die Kombination aus Kraft-Wärme-Kopplung, Geothermieanlage, Energiespeicher und regenerativer Fernkälteerzeugung machen den Energiestandort Süd hocheffizient, umweltfreundlich und flexibel steuerbar.
Geplante Standortentwicklung
Geothermie / Wärmestation
- Regenerative Wärmeerzeugung > 60 MWth
- Wärmeeinspeisung seit Frühjahr 2021
Wärmespeicher
- Flexibilisierung des Anlagenparks
- ca. 57.000 m³ Inhalt, 50 m Höhe
- Bauzeit: 2023 - 2025
Fernkälte
- Effiziente & umweltfreundliche Kälteerzeugung durch freie Kühlung, Absorption, Kompression
- 1. Bauabschnitt ca. 13 MWth, Endausbau max. 35 MWth
- Bauzeit Abschluss 1. Bauabschnitt ca. 2029
KWK-Anlagen
- Effiziente, flexible & umweltfreundliche Strom- & Wärmeerzeugung
- ca. 3 - 6 % höhere Gasturbinenwirkungsgrade
Modernisierung GuD2
- ca. 435 MWth, 430 MWel
- Inbetriebnahme erfolgt
Erneuerung GuD1
- ca. 170 MWth, 215 MWel
- Bauzeit: in Umsetzung