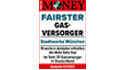CO₂-Kompensation für Unternehmen
Unvermeidbare Emissionen ausgleichen und Bescheinigung erhalten
Unverbindlich anfragenCO₂-Kompensation mit den Stadtwerken München
Sie sind auf dem Weg ein klimafreundliches Unternehmen zu werden? Mit unseren Produkten können Sie Ihre unvermeidbaren Emissionen kompensieren und (optional) einen Klimabeitrag in Deutschland leisten. Auch wenn Sie ausschließlich zum Klimaschutz in Deutschland beitragen möchten, haben wir das richtige Produkt für Sie.
CO₂-Ausgleich durch Emissionszertifikate aus internationalen Klimaschutzprojekten
M-Kompensation
Mit M-Kompensation können Sie Ihre unvermeidbaren CO₂-Emissionen ausgleichen. Die Kompensation erfolgt durch die Stilllegung von CO₂-Emissionszertifikaten aus ausgewählten internationalen Klimaschutzprojekten.
- Gold Standard
Alle Projekte sind nach einem der strengsten internationalen Qualitätsstandards zertifiziert. Für den „Gold Standard“ muss das Kriterium „Zusätzlichkeit“ erfüllt sein. Das bedeutet, dass das Projekt nur durch die Einnahmen aus dem Zertifikatsverkauf realisierbar ist. - Ausschließlich ex-post-Zertifikate
M-Kompensation verwendet nur ex-post-Zertifikate. Die Emissionen wurden also bereits nachweisbar eingespart. Die Ausgabe der Zertifikate erfolgt im Nachhinein. - Mindestens drei SDGs erfüllt
Die ausgewählten internationalen Klimaschutzprojekte berücksichtigen die lokale Gesellschaft, indem sie die nachhaltigen Entwicklungsziele (sog.(Sustainable Development Goals oder SDGs) in den jeweiligen Projektregionen fördern.
CO₂-Kompensation mit Zusatzengagement in Deutschland
M-Kompensation Plus
Mit M-Kompensation Plus gleichen Sie Ihre CO₂-Emissionen aus und treiben gleichzeitig aktiv die Energiewende in Deutschland voran. Neben der CO₂-Kompensation durch die Stilllegung von CO₂-Emissionszertifikaten aus internationalen Klimaschutzprojekten leisten Sie einen zusätzlichen Beitrag zur CO₂-Reduktion in Deutschland: Gemeinsam mit den SWM fördern Sie den Ausbau, die Erhaltung und/oder den Betrieb von Anlagen der erneuerbaren Energien in Deutschland.
Transparenz
Die SWM streben eine unabhängige Prüfung der Verwendung der Beträge an, die im Rahmen des Produktes M-Kompensation Plus zweckgebunden geleistet wurden.
- Erhaltung bestehender Erneuerbare-Energien-Anlagen
In Deutschland erhalten Erneuerbare-Energien-Anlagen nur für die ersten 20 Jahre nach ihrer Inbetriebnahme eine Förderung gemäß Erneuerbare-Energie-Gesetz. Nach dieser Förderungsphase werden einige dieser Anlagen nicht weiter betrieben.
Diese Bestandsanlagen könnten aber noch über Jahre Strom erzeugen. Ihr Weiterbetrieb trägt direkt dazu bei, CO2 in Deutschland zu vermeiden, denn Bestandsanlagen verursachen weniger CO2-Emissionen als die Errichtung neuer Anlagen. - Ausbau von Erneuerbare-Energien-Anlagen in Deutschland
Neue Erneuerbare-Energien-Anlagen werden in Deutschland oft nicht in ihrem vollen, potenziellen Maße errichtet. Beispielsweise bleiben technisch geeignete Dachflächen für die Erzeugung von Solarenergie ungenutzt, obwohl diese einen großen Beitrag zur Energiewende leisten könnten.
Um die vorhandenen Potenziale für erneuerbare Energien optimal zu nutzen, möchten die SWM mithilfe des Produkts M-Kompensation Plus solche Projekte unterstützen. Damit wird der Anteil der regenerativen Energien an der Stromerzeugung weiter erhöht.
Erfahren Sie mehr zu den Projekten
Hier finden Sie den allgemeinen Statusbericht über Projekte der erneuerbaren Energien, die die SWM mit Mitteln aus dem Produkt M-Kompensation Plus unterstützt haben:
Allgemeiner Statusbericht
CO₂-Ausgleich mit M-Kompensation Plus
Hochwertige Qualität: Internationale Klimaschutzprojekte gemäß Gold Standard
Die von uns ausgewählten Klimaschutzprojekte sind alle mit dem "Gold Standard" zertifiziert – einem der aussagekräftigsten und strengsten Standards für CO2-Ausgleichsprojekte. Außerdem tragen diese Klimaschutzprojekte zu einer nachhaltigen Entwicklung in den jeweiligen Projektregionen bei und erbringen dort einen sozialen Mehrwert.
Umweltschutz mit sozialem Mehrwert: Sustainable Development Goals
Wir sind der Meinung: Klimaschutzprojekte können langfristig nur erfolgreich sein, wenn sie auch die Bedürfnisse der Gesellschaft in der jeweiligen Projektregion berücksichtigen. Daher wählen wir Klimaschutzprojekte aus, die auch SDGs fördern.
Kommunikation und Marketing
Wir unterstützen Sie bei der Kommunikation:
- Sie erhalten eine Bescheinigung über die Kompensation und bei M-Kompensation Plus über Ihren Zusatzbeitrag für den Klimaschutz in Deutschland.
- Wir erstellen für Sie eine individuelle Internetseite, die Sie zur Kommunikation gegenüber Ihren eigenen Kund*innen verlinken können.
- M-Kompensation Plus: Auf der SWM Webseite finden Sie einen allgemeinen Statusbericht über Projekte der erneuerbaren Energien, die die SWM unterstützt haben.
Warum M-Kompensation von den SWM?
Ihre Vorteile auf einen Blick
Das sagen unsere Kund*innen
„RTLZWEI hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2025 klimaneutral nach Scope 1 und Scope 2 zu sein. Ebenfalls soll die Klimabilanz im Hinblick auf Scope 3 in den nächsten Jahren signifikant verbessert werden. Bei diesen Vorhaben bietet das Angebot der SWM eine sehr gute Möglichkeit, aktuell noch nicht vermeidbare Emissionen zu kompensieren und die Kompensation durch eine regionale Komponente zu ergänzen. Hervorzuheben sind auch die auf das jeweilige Unternehmen zugeschnittene Landingpage mit regelmäßigen Updates sowie der persönliche Kontakt und die damit verbundene unkomplizierte Kommunikation.“
Stefan Uhl, Leitung Programmverbreitung & Gebäudetechnik
„Als Unternehmen mit starker regionaler Verwurzelung war es uns wichtig, uns auch regional zu engagieren. Außerdem wollten wir mit einem vertrauenswürdigen und seriösen Partner zusammenarbeiten. Die SWM haben uns mit ihrem Angebot überzeugt und wir waren sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit.“
Darko Stanic, Geschäfts- und Betriebsleiter
https://www.augustinerkeller.de/de
„Als Full-Service Markenberatung lieben wir bei Dietrich Identity die Marke. Weil sie nachhaltig nach innen und außen wirkt. Wir können Strategie. Aber krempeln auch für die Umsetzung die Ärmel hoch. Und wir entdecken mit unseren Kunden das, was jeder braucht, aber die Wenigsten haben. Echte Werte.
Nachhaltigkeit bedeutet für uns auch seit Jahren der Bezug von M-Ökostrom Business der SWM aus erneuerbaren Energien. So lag eine Zusammenarbeit mit der SWM in Sachen CO2-Kompensation nahe und wir freuen uns, die gemeinsame Zusammenarbeit auszubauen.“
Fridolin Dietrich, Gründer und Geschäftsführer von Dietrich Identity
https://www.dietrichid.com/
„Wir sind besonders stolz, dass wir unser Wiesnzelt komplett CO2-frei betreiben. Neben Einsparungen durch die Nutzung von Elektrofahrzeugen und Investitionen in Energieeffizienz, gleichen wir seit letztem Jahr die verbliebenden Emissionen mit den Stadtwerken München aus. Uns haben die hochqualitativen und zertifizierten Projekte überzeugt. Wir haben die Zusammenarbeit als sehr angenehm und vertrauensvoll empfunden.”
Siegfried Able, Geschäftsführer
https://www.marstall-oktoberfest.de/
„Mithilfe der Stadtwerke München konnten wir, die VIA Consult, im Jahr 2021 durch die Kompensation von 63 Tonnen CO2 die Klimaneutralität erreichen. Wir sind sehr froh über die zuverlässige und reibungslose Zusammenarbeit. Die Auswahl an internationalen Projekten reicht von Windkraft in Indien, über Energieeffizienz in Ghana bis hin zur Aufforstung in Panama. Besonders die Möglichkeit, mit einem geringen Aufschlag den Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland zu fördern, gefällt uns sehr gut. Wir empfehlen die Stadtwerke München bereits an unsere Kunden weiter!”
Christoph Hebbeker, Consultant
https://via-consult.de/
Wie funktioniert freiwillige CO₂-Kompensation?
Freiwillige CO₂-Kompensation basiert auf dem globalen Konzept, CO₂-Emissionen, die an einer Stelle nicht vermieden werden können, zumindest an anderer Stelle einzusparen.
Die Finanzierung von internationalen Klimaschutzprojekten, welche vor Ort den Treibhausgasausstoß reduzieren, ermöglichen es, die eigenen noch unvermeidbaren Emissionen auszugleichen. Ein Beispiel für ein solches Projekt wäre die Finanzierung des Aufbaus einer Windkraftanlage in einem Entwicklungsland. Denn wo die Emissionen schlussendlich reduziert werden, ist für den Effekt auf das Klima größtenteils unerheblich. Maßgebend ist dabei, dass internationale Qualitätsstandards eingehalten werden.
Im ersten Schritt muss sich das Unternehmen zunächst mit seiner eigenen CO₂-Bilanz auseinandersetzen. Darauf aufbauend sollte es sich kurz- sowie langfristige Reduktionsziele setzen und Maßnahmen ableiten, die zur größtmöglichen Einsparung der berechneten Gesamtemissionen führen. Die Menge an Emissionen, die bestehen bleibt, nachdem diese Maßnahmen umgesetzt wurden, bezeichnet man als unvermeidbare Restemissionen. Diese (noch) verbliebene Emissionsmenge kann in einem letzten Schritt durch die finanzielle Unterstützung von Klimaschutzprojekten ausgeglichen werden.
Warum freiwillig CO₂-Emissionen kompensieren?
Die Begrenzung des Klimawandels und seiner weitreichenden Folgen ist eine der großen Herausforderungen unserer Zeit. Mit der Strategie, „klimaneutral“ zu werden, können sich Unternehmen vorstellbare und glaubwürdige Ziele setzen, ihr eigenes freiwilliges Engagement geltend machen und sich aktiv für den Klimaschutz engagieren.
Die freiwillige Kompensation spielt immer dann eine Rolle, wenn Emissionen sich heute (noch) nicht vermeiden lassen. Durch die Kompensation können diese Emissionen bereits heute zumindest an anderer Stelle ausgeglichen werden. Der freiwillige Kauf von Emissionszertifikaten in Höhe der unvermeidbaren Restemissionen ermöglicht dem Unternehmen bilanzielle Klimaneutralität.
Warum können Unternehmen nicht in Deutschland kompensieren und dafür CO₂-Zertifikate erhalten?
Bei Projekten in Deutschland ist insbesondere der Ausschluss einer doppelten Zählung bzw. Beanspruchung eine Herausforderung. Das liegt daran, dass sich Deutschland CO₂--Einsparungen, die in Projekten im eigenen Land vollzogen werden, seit Inkrafttreten des Kyoto-Protokolls bereits in einer nationalen Klima-Bilanz anrechnet (Nationally Determined Contributions). Eine zusätzliche Erfassung in der Bilanz eines Unternehmens würde zu einer zweifachen Zählung und damit effektiv zu einer Steigerung der Emissionen führen.
Sie haben Fragen oder wollen sich unverbindlich beraten lassen?
Wir sind gerne für Sie da!
- +49 89 2361-9222